Und dieses im Grunde optimistische Lebensgefühl hatte Auswirkung auf mein Denken und Handeln in vielen Bereichen. Auch unsere damaligen politischen GegnerInnen hatten dieses im Grunde optimistische Lebensgefühl, denn es war dem Zeitgeist einer ganzen Generation entsprechend.
Um diese Bereiche möchte ich mich in nächster Zeit in der LUST bei heutigen Jugendlichen kümmern, da ich sie in ihrem Handeln und Denken oft nicht verstehen kann. Dazu muss ich aber auch ihr Lebensgefühl kennen lernen.
Junge Menschen, die heutzutage an ihre Zukunft denken, können meiner Meinung nach nicht das gleiche optimistische Lebensgefühl haben wie wir, weil dazu kein Anlass besteht. Möglicherweise haben sie es trotzdem, dann aber nur durch Realitätsflucht. Ist Eskapismus unter den Jugendlichen weit verbreitet?
Weil ich es nicht weiß, will ich einfach unterschiedliche Jugendliche befragen, männliche und weibliche, hetige und homosexuelle, unterschiedlicher Bildung und unterschiedlicher sozialer Stellung. Aber wie findet man Jugendliche, denen es Spaß macht, in solch einer Form ausgefragt zu werden?
Liebe LUST-LeserInnen, könnt Ihr mir da nicht mal helfen? Wenn die ersten Interviews stattgefunden haben, werde ich sie in der LUST veröffentlichen, um Euch an diesen Prozessen teilnehmen zu lassen.
Heißt ein Buch, geschrieben von dem Jedediah Purdy, dass in den Medien gefeiert wird als Werk, dass den Trend neuen Denkens über die vom Neoliberalistmus beeinflussten Jugendlichen aufweise. Im Klappentext heißt es: „Was ist passiert? Immer cool, kritisch und leicht distanziert: so lautet das moralische Vermächtnis der Großen Dekonstruktion – eine intellektuelle Trümmerlandschaft, in der eine ganze Generation herumirrt.
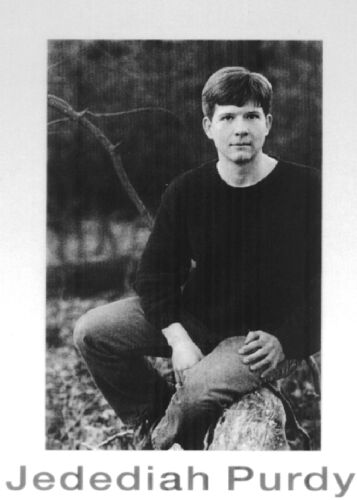 Ein Unter-30-Jähriger? Ich
lese: “Jedediah Purdy wurde 1974 auf einer Farm in Chloe
(West-Virginia) geboren, wo er auch aufwuchs. Privatunterricht
durch die Eltern, mit 16 Jahren Eintritt in die Phillips Exeter
Academie in New Hamshire. Nach dem Abschluss Rückkehr nach
West-Virginia; ein Jahr aktive Mitarbeitin der Umweltbewegung
auf politischer wie auf kommunaler Ebene. Danach Collegbesuch
in Harvard und Jurastudium in Yale. Zur Zeit ist Purdy Stipendiat
der “New America Foundation”, Washington, D.C..”
Ein Unter-30-Jähriger? Ich
lese: “Jedediah Purdy wurde 1974 auf einer Farm in Chloe
(West-Virginia) geboren, wo er auch aufwuchs. Privatunterricht
durch die Eltern, mit 16 Jahren Eintritt in die Phillips Exeter
Academie in New Hamshire. Nach dem Abschluss Rückkehr nach
West-Virginia; ein Jahr aktive Mitarbeitin der Umweltbewegung
auf politischer wie auf kommunaler Ebene. Danach Collegbesuch
in Harvard und Jurastudium in Yale. Zur Zeit ist Purdy Stipendiat
der “New America Foundation”, Washington, D.C..”
Wenn er als Kind von seinen Eltern auch unterrichtet wurde, ist denn dann seien neue Message nicht in Wirklichkeit ein Zurück zur Natur? Dann könnte ich den Aufruhr um seine Thesen nicht verstehen.
Bevor ich die 19,80 Euro ausgebe, um mir dieses Buch zu kaufen, versuche ich, in den Rezensionen Näheres über Purdy und sein Buch zu erfahren:
PURDY, Jedediah (2000): Das Elend der Ironie.
Wo der Zeitgeist im Fitnesscenter weht, stirbt das öffentliche Leben. Plädoyer für eine neue Politik, in: Die ZEIT Nr.37 v. 07.09.
PURDY, Jedediah (2002): Was war Neoliberalismus? World of Passions: How to Think About Globalization Today lautet der Originaltitel eines großen Essays, in dem der junge amerikanische Autor Jedediah Purdy untersucht, an welchen Defekten das neoliberale Projekt gescheitert ist. Warum führt selbst gut gemeinte Liberalisierung allzu häufig in illiberale und undemokratische Verhältnisse? Purdys Diagnose: Die Bannerträger des Neoliberalismus haben die Bedeutung menschlicher Leidenschaften ignoriert.
Kommentar: In Deutschland formiert sich gerade eine selbstgerechte Bobokratie. Dieses Kampfbündnis der neoliberalen Besitzstandwahrer und -mehrer, bestehend aus alter und neuer Elite, die den Ausverkauf der Arbeitnehmergesellschaft betreibt, indem sie Junge gegen Alte und Arbeitsplatzbesitzer gegen Erwerbslose ausspielt, betreibt ein perfides Spiel, bei dem alle verlieren werden und der größte Verlierer ist die demokratische Kultur in unserem Land.
Jedediah PURDY hat ihre Strategie in diesem lesenswerten Essay beschrieben: „Für die Theoretiker des Washington-Konsens war die Politik der Feind, weil sie der Ort war, an dem sich so antireformerische Haltungen wie die Angst vor der Veränderung und die Anhänglichkeit an bestehende Verhältnisse Ausdruck verschaffen konnten.
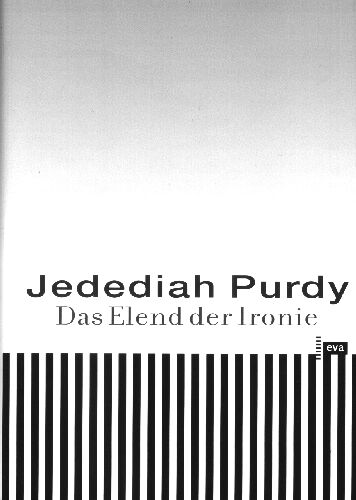 finden,
dass die umfangreichen politischen Reformen, die für eine
offene Markt- und Wettbewerbsgesellschaft nötig sind, zustande
kommen, ohne das ihnen eine tiefe Krise vorausgeht, dann wäre
darüber nachzudenken, ob solch eine Krise nicht mit Absicht
herbeigeführt werden sollte, um den politischen Reformstau
aufzulösen« Aus dieser Perspektive ist Politik dann
nur noch in dem Maße von Interesse, wie sie der Durchsetzung
der ökonomischen Logik im Wege steht.“ Feuilleton-Revoluzzer
von Konrad ADAM über Sascha LEHNARTZ bis zu Arnulf BARING
versuchen in Deutschland offenbar gerade diese antidemokratische
Strategie aus den Arsenalen der psychologischen Kriegsführung
in die Tat umzusetzen.
finden,
dass die umfangreichen politischen Reformen, die für eine
offene Markt- und Wettbewerbsgesellschaft nötig sind, zustande
kommen, ohne das ihnen eine tiefe Krise vorausgeht, dann wäre
darüber nachzudenken, ob solch eine Krise nicht mit Absicht
herbeigeführt werden sollte, um den politischen Reformstau
aufzulösen« Aus dieser Perspektive ist Politik dann
nur noch in dem Maße von Interesse, wie sie der Durchsetzung
der ökonomischen Logik im Wege steht.“ Feuilleton-Revoluzzer
von Konrad ADAM über Sascha LEHNARTZ bis zu Arnulf BARING
versuchen in Deutschland offenbar gerade diese antidemokratische
Strategie aus den Arsenalen der psychologischen Kriegsführung
in die Tat umzusetzen.
LEITGEB, Hanna (2002): Im Jenseits der Ironie, Jedediah Purdy, Amerikas Antwort auf die Spaßgesellschaft, startet einen neuen Angriff auf die USA und denkt über sich selber nach, in: Literaturen Nr.11, November.
SCHWARZ, Patrik (2002): Was für ein ordentlich junger Mann. Als Jungstar der Politphilosophie erfüllt Jedediah Purdy das Bedürfnis vieler Amerikaner nach neuer Ernsthaftigkeit, in: TAZ v. 08.11.
SCHWARZ, Patrik (2002): „Absurder Optimismus“. Die zentrale Erfahrung wird die Ungleichheit innerhalb der Generation sein: Der amerikanische Philosoph Jedediah Purdy über die Zukunft der Dreißigjährigen, das Ende der New Economy und darüber, warum es okay ist, seine Eltern zu verteidigen, in: TAZ v. 11.11.
Inhalt: PURDY erteilt dem Kampf der Generationen eine Absage und thematisiert stattdessen die Ungleichheiten innerhalb einer Alterskohorte: „Die Internet-Bubble ist geplatzt. Gehts jetzt zurück zur Erfahrung der Generation X, wie sie Douglas Coupland schon einmal Ende der 80er-Jahre beschrieb: eine Jugend, der es zwangsläufig dreckiger gehen wird als ihren Eltern?
Die Coupland-Einstellung, es werde immer abwärts gehen, hat etwas gemeinsam mit dem absurden Optimismus der New Economy: Beide Fantasien spiegeln die Tendenz wider, von begrenzter Erfahrung kühn zu extrapolieren - einmal nach unten, einmal nach oben. Beides war natürlich eine Karikatur. In Wirklichkeit wird die zentrale Erfahrung unserer Generation die Ungleichheit innerhalb der Generation sein. Anders als früher geht es heute nicht mehr um den Kampf einer Generation gegen die andere - sondern um den Kampf innerhalb unserer Generation um ökonomische und soziale Perspektiven.“
NOLTE, Paul (2002): Der amerikanische Dissens. Jedediah Purdy kritisiert die ironische, unpolitisch-distanzierte Haltung der kommerzialisierten Popkultur in den USA. Seine Streitschrift ist furios, naiv - und voller interessanter Anregungen, in: TAZ v. 17.09.
Inhalt: Paul NOLTE stellt das Buch „Das Elend der Ironie“ („For Common Things“) des Kommunitaristen Jedediah PURDY vor: „Und welche Ironie ist es, die Purdy kritisiert? Es ist vor allem die ironische, unpolitisch-distanzierte Haltung, die in der kommerzialisierten Popkultur vorgeführt wird, in Sitcoms wie »Seinfeld« - ein Gestus, der in Deutschland vielleicht in Florian Illies »Generation Golf« seine Entsprechung hat. Schön und gut, aber der Ironie als geistigem und politischem Prinzip wird damit Unrecht getan (...). Die ironische Haltung in der Politik ist schließlich ein wichtiges Korrektiv gegen alle Formen von Fundamentalismus und falscher Verbohrtheit (...).Aber das ändert nichts daran, dass hier ein wichtiges und schwungvoll geschriebenes politisches Manifest eines Autors vorliegt, der nicht nur in Amerika etwas zu sagen hat“.
FREUND, Wieland (2002): Eintritt frei ins postironische Zeitalter. Purdy und die Anti-Rebellen gegen Uneingentlichkeit, in: Welt v. 31.10.
Inhalt: FREUND stilisiert den US-amerikanischen Kommunitaristen Jedediah PURDY, dessen Buch „Das Elend der Ironie“ gerade auf deutsch erschienen ist, zum Anti-Rebellen. Für FREUND stehen die Grünen in der Tradition PURDYs, während die FDP als „ängstlich, opportun, bindungsunfähig“ charakterisiert wird. Mit dem Wahlsieg der Grünen und der Niederlage der FDP ist gemäß FREUND das “Zeitalter der Postironie“ eingeleitet.
MOHR, Reinhard (2002): Also sprach Jedediah. Mit seinem Buch über das “Elend der Ironie“ erregt der junge amerikanische Autor Jedediah Purdy nun auch in Deutschland Aufsehen. Doch so treffend die Kritik am zynischen Kult der Oberfläche ist - zum politischen Diskurs steuert Purdy kaum mehr als guten Willen bei, in: Spiegel Nr.46 v. 11.11. Kommentar: Der Spiegel glänzt mit Einfallslosigkeit und übernimmt einfach den Titel vom Harper’s Magazine, um über PURDY zu spotten. MOHR beherrscht die Kunst des Zaungasts. Er bleibt von der Spaßgesellschaft genauso weit entfernt wie von der Neuen Ernsthaftigkeit eines Jedediah PURDY.
Und das habe ich selbst in dem o.a. Buch gelesen: Purdy empfindet die Welt des Neo-Liberalismus als Ursache einer menschlichen Verrohung, die es dem Individuum verbietet, in irgendeiner Form am Gesamtgeschehen teilzunehmen. Er nennt die Haltung, die daraus entstanden ist und die er beobachtet: Ironie. “Ich glaube nicht daran, dass uns die Ironie, und sei sie noch so massiv, davon überzeugt hat, dass es das Wirkliche, das Wahre, das Unsere nicht gibt. Wir glauben doch (wenn wir es nur zulassen), dass es Dinge gibt, auf die wir vertrauen können, Worte, die wir im Ernst sagen können. Ironie macht uns vorsichtig und verlegen in unsrer Überzeugung.
Ich werte diese Aussagen so, dass er an bodenständigen Ansichten, geboren aus dem Farmer-Alltag, hängt und die Kritik aus Sicht des Neo-Liberalismus an diesen rückständigen Ansichten im Grunde versteht. Und weil ihm diese Kritik unbehaglich ist, wehrt er sich dagegen. Er empfindet sie als inhaltsleer, nennt sie einfach “Ironie”, da dieses Wort keinen Inhalt, sondern eine Methode zum Kritisieren darstellt. Das geht für mich auch aus dem folgenden Zitat hervor: “Ich verstehe mein Buch als eine Einladung, unsere Aufmerksamkeit wesentlichen und vernachlässigten Dingen zuzuwenden, und als Vorschlag, wie dies aussehen könnte. Es ist dies ein Liebesbrief eines jungen Mannes an die Möglichkeiten der Welt, verfasst in der Annahme, dass andere ihre eigene Sehnsucht darin wiedererkennen und antworten werden.” (S. 17).
”Die ironische Antwort auf diese ungewissen Strömungen ist ein beflissenes sich Fügen. Das unterscheidet den Ironiker von dem schwärzeren und bekannteren Typus des Zynikers. Der Zyniker, der sich wenigstens ein gewisses Restgefühl von eigener Überlegenheit bewahrt hat, bleibt zuhause und schimpft auf bornierte und unernste Partybesucher. Der Ironiker hingegen besucht die Party, ohne sich wirklich auf sie einzulassen. Und brilliert dafür mit den besten Bonmots des Abends.
Lösung dieses Problem könnte die Politik sein. “Seit der radikalen Epoche der Französischen Revolution besteht die Verheißung, dass Politik die Situation des Menschen auf elementare Weise zum Besseren wenden könnte. Politik könnte demnach all die unnötigen, grausamen und erbitterten Auswüchse der Geschichte tilgen und sie durch gerechte und menschliche Gesetze ersetzen, bei denen Menschen zum ersten mal so frei leben würden, wie sie geboren wurden.“ (S. 9). Aber ach, auch die Politiker sind Ironiker geworden und handeln inhaltsleer. Selbst die Religion wird nur nach Interessen auszugsweise genutzt. Daher kann nichts anderes entstehen, dass sich die ironisch gewordenen Menschen in ihrer Inhaltsleere auch von der Politik abwenden.
Wenn Politik als eigenständige Form des Theaters begriffen wird, darf es nicht überraschen, dass ihr Personal aus der Unterhaltungsbranche stammt. Die vorherrschende Einstellung zur Politik (nach der Gleichgültigkeit) sieht in ihr ein Zwitterwesen aus Zuschauersport und Promi-Kultur. Die Talkshows am Sonntagvormittag bedienen den Zuschauerstandpunkt, indem sie konkurrierende Darstellungen geben, mit wem es bergauf und mit wem es bergab geht und wo der smarte Anleger demnächst investiert.” (S. 53f) Ist diese Auffassung von Purdy noch Ironie oder schon Zynismus? Auf jeden Fall sieht er auch eine Inhaltsleere in der Politik, nicht nur in der Innen- sondern auch der Außenpolitik. “Ein großer Teil der heutigen Außenpolitik dieses Landes beruht dann auch auf der Überzeugung, dass wir alle demselben Ziel zustreben.
Die amerikanische Nachsicht mit chinesischen Menschenrechtsverletzungen wird mit der Überzeugung verteidigt, dass freie Märkte unfehlbar befriedend wirken und dass Regierungen, die McDonald´s zulassen, nicht nur nicht gegeneinander Krieg führen, sondern letzten Endes freie Wahlen abhalten und von der Misshandlung ihrer Bürger absehen werden.” (S. 63f)
Auch im internationalen Bereich sei anstelle einer Verantwortung die Ironie getreten. “Die Kluft zwischen Reich und Arm in der Weltwirtschaft werde größer, erklärte mein früherer Schulfreund. Befürchtungen, wonach die amerikanischen Löhne in dem Maße nach unten eingeebnet würden, wie Berufstätige in der ersten und der dritten Welt zunehmend um dieselben Arbeitsplätze konkurrierten, seien nicht unbegründet. Die ärmsten Länder der Welt würden dabei wohl Vorteile haben, die eigentlichen Gewinner aber seien Menschen wie er, Mitglieder der Finanzelite, die das neue mobile Kapital auf den Weg bringen konnten. Der Gang der Dinge stehe fest. Er könne zwar nicht sagen, dass er ihn unterstütze, aber er sehe auch keinen Grund, zu den Verlierern zu zählen.” (S. 101)
Dies alles überzeugt den Autor noch mehr, sich wieder einmischen zu wollen. “Das mangelnde Interesse an politischem Engagement mündet auch in persönliches Unbehagen. Der Verfall der öffentlichen Dienste, der ehrgeizige junge Leute veranlasst, ihnen aus dem Weg zu gehen, ist zum Teil ein Produkt der Politik. Mit der steigenden Anzahl der Gefängnisinsassen, in Gang gesetzt durch Verhängung langer Freiheitsstrafen und verstärkt durch die Privatisierung der Gefängnisse, erweisen wir uns einen schlechten Dienst.
Wenn man nicht gerade sehr reich ist, nimmt man durch bürgerschaftliche Institutionen – vermittelt – am politischen Leben teil. Ob bei der Unterstützung eines Kandidaten oder beim Protest gegen ein Vorhaben, wir alle agieren in bereits bestehenden Zirkeln: Nachbarschaftsvereinigungen, Gewerkschaften, Berufsgruppen, .... Durch politische Arbeit werden die Beziehungen erweitert, verändert, manchmal auch aufgebrochen. Unsere Lebensqualität entsteht überhaupt erst in Beziehungen, die zwar nicht rein politisch, aber im weitesten Sinne bürgerschaftlich sind. Geben wir diese Beziehungen auf, verspielen wir auch die Möglichkeiten der Einflussnahme und Gestaltung.” (S. 106f)
Und das ist dann wohl der Kern seines Appells, nämlich dass man sich wieder verantwortlich einmischen soll. Das soll also der Aufbruch der neuen Jugend sein, die von dem Zeitgeist des Neoliberalismus, der Ironie, genug hat? Wenn es wahr wäre, wäre dies doch immerhin ein Anfang. Ich befürchte allerdings, dass es sich anders verhält. Sein Protest in diesem Buch erscheint mir eher aus der Sicht des bodenständigen Farmers aus West-Virginia stattzufinden, der im weltweiten Neo-Liberalismus, in der Globalisierung, noch nicht ganz angekommen ist. Das Buch “Das Elend der Ironie” ist bei eva erschienen, hat 214 Seiten, kostet 19,80 Euro, ISBN 3-434-50538-5
Bei meiner Internet-Suche nach der Sichtweise der heute Jugendlichen bin ich dann noch auf eine Autorin gestoßen, die sich in den USA eine Zeitlang nicht im gehobenen Bildungsbürgertum und auch nicht in der oberen Finanzwelt aufgehalten hat. Ein bisschen erinnert mich das an Günther Walraff.
ist der zusammenfassende Titel diverser Veröffentlichungen der US-amerikanischen Publizistin Barbara Ehrenreich.

Ihre Kurzbiographie: Studium der Chemie, Physik und Molekularbiologie, 1983 Sachbuch “The Hearts of Men“ (Die Herzen der Männer), 1989 Sachbuch „Fear of Falling“ (Angst vor dem Absturz), 2001 Sachbuch „Arbeit Poor“ Ihr aktuellster Beitrag heißt “Die kleinen Leute als Komparsen”
Unterwegs in der Dienstleistungsgesellschaft (2001) München: Kunstmann. Klappentext zu „Arbeit poor“:
„Die Dienstleistungsgesellschaft ist unsere Zukunft, heißt es. Barbara Ehrenreich hat diese Welt des Jobwunders erkundet. Um herauszukriegen, wie man im sogenannten »Niedriglohnsektor« lebt, ließ sie sich als Zimmermädchen anstellen, arbeitete als Serviererin, als Altenpflegerin und als Verkäuferin. Sie erfuhr, dass bei Einstellungen von Persönlichkeits- und Drogentests, kaum aber von Stundenlohn gesprochen wird, stellte fest, wie viel Kenntnisse auch die angeblich einfachen Tätigkeiten erfordern und wie schnell der Mut verloren geht, sich gegen unzumutbare Arbeitsbedingungen zur Wehr zu setzen.“
Ein Kommentar:
Die Single-Hierarchie in der beschleunigten Gesellschaft
Was Peter GLOTZ für den Digitalen Kapitalismus prophezeit, das ist in den USA bereits
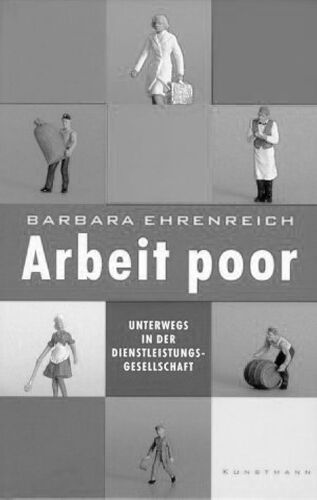 deutlich
zu sehen. Die US-amerikanische Publizistin Barbara EHRENREICH
hat sich im Segment, der personenbezogenen Dienstleistungen à
la WALRAFF kundig gemacht. Diesen Dienstleistungssektor zählt
GLOTZ zum dritten Drittel, in dem die „Entschleuniger“
ihr Dasein fristen müssen.
deutlich
zu sehen. Die US-amerikanische Publizistin Barbara EHRENREICH
hat sich im Segment, der personenbezogenen Dienstleistungen à
la WALRAFF kundig gemacht. Diesen Dienstleistungssektor zählt
GLOTZ zum dritten Drittel, in dem die „Entschleuniger“
ihr Dasein fristen müssen.
„Überall sind Jobs schnell zu haben, aber die Mieten stark gestiegen. Beides ist eine direkte Folge des Booms. Der Aufschwung, der den Armen auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, schadet ihnen auf dem Wohnungsmarkt; auf dem einem profitieren sie vom Wohlstand der Reicheren, auf dem anderen müssen sie gegen sie antreten. ‘Also bin ich gar kein Armuts-, sondern vielmehr ein Wohlstandopfer’, schließt Ehrenreich.“ (Berliner Zeitung v. 09.10.2001)
Im Gegensatz zur allgemein üblichen Meinung gehören Singles nicht generell zu den Beschleunigern, d.h. den Besserverdienden, sondern zunehmend zu den Geringverdienenden. Die Datenlage ist aus politischen Gründen leider unzureichend.
Der Mainzer Soziologe Stefan HRADIL hat 1995 Daten veröffentlicht, wonach 1988 in Deutschland mehr als ein Fünftel der erwerbstätigen 25-55jährigen Alleinlebenden mit weniger als 1200,- DM Nettoeinkommen pro Monat auskommen mussten. Obwohl im Erwerbsalter wesentlich mehr Männer im Einpersonenhaushalt wohnen, gehören sie prozentual gesehen fast genauso oft zu den Geringverdienern wie weibliche Singles. Dies ist ein Tatbestand, der von der dominierenden feministischen Forschung ausgeblendet wird. Seitdem dürfte sich die Lage weiter zuungunsten der männlichen Geringerverdiener verschlechtert haben.
Was ist dran am Jobwunder USA? Die amerikanische Journalistin Barbara Ehrenreich hat es im Selbstversuch erkundet. Sie schlug sich als Serviererin, Verkäuferin und Putzfrau durch. Das Magazin veröffentlicht einen Auszug aus ihrem Buch Arbeit poor, in: Frankfurter Rundschau v. 08.09.
Rezension
KNIPPHALS, Dirk (2001): Mrs. Ehrenreich im Wunderland.
Arm sein in Amerika: Wie geht das? Wie funktioniert das? Welche Fähigkeiten muss man mitbringen? Die amerikanische Publizistin Barbara Ehrenreich geht diesen Fragen mit der altmodischen journalistischen Methode nach: Sie zieht einfach selbst los und findet es heraus - die Studie „Arbeit poor“ in: TAZ v. 29.09.
Klappentext zu „Angst vor dem Absturz Das Dilemma der Mittelklasse” (1992): Barbara Ehrenreich, die bekannt ist für ihre angriffslustigen Essays, nimmt in Angst vor dem Absturz das Innenleben der amerikanischen Mittelklasse unter die Lupe. Sie verfolgt den Weg dieser »neuen Mittelklasse« von den »linksliberalen« sechziger Jahren bis zur Yuppiekultur der achtziger Jahre und erzählt die Geschichte einer Wandlung: eine Geschichte, die mit Optimismus und Selbstlosigkeit anfängt und in Resignation und Ratlosigkeit endet.“
Klappentext zu „Die Herzen der Männer. Auf der Suche nach einer neuen Rolle“ (1983): Der »Krieg der Geschlechter« und die »Lösung geschlechtsspezifischer Rollenkonflikte« bestimmten in den letzten zwanzig Jahren die - nach weitverbreiteter Ansicht von Frauen ausgelöste - Diskussion über die Beziehungen der Geschlechter zueinander.
Barbara Ehrenreich vertritt die These, dass dabei - versteckt hinter viel Rhetorik - eine der wichtigsten Veränderungen übersehen wurde: der Verfall des Moral-Gesetzes, nach dem Männer zuallererst Ernährer einer Familie sind. Die Autorin weist nach, dass Männer durch Fluchttendenzen aus dieser traditionellen Verantwortung als Brotverdiener mehr im Zusammenleben der Geschlechter verändert haben als Frauen - und dies seit den frühen Fünfzigern, mehr als zehn Jahre vor dem Sichtbarwerden der sogenannten Frauenbewegung.“
DIEDERICHSEN, Diedrich (2002): Ein Alien für alle: Nach zwanzig Jahren kommt Steven Spielbergs „E.T.“ wieder ins Kino. Der nette Außerirdische hat die amerikanische Kulturpsychologie geprägt und wirkt bis in heutige Zuwanderungsdebatten fort, in: Die ZEIT Nr.14 v. 27.03.
Der Poptheoretiker DIEDERICHSEN hat ein Herz für den außerirdischen Sozialarbeiter E.T. und die vaterlose Kleinfamilie:
„Konkret wird E.T. nur in einem Punkt: nämlich bei der Bestimmung der näheren Umstände seines Willkommenseins. Er ist nicht einfach auf diesem Planeten willkommen: Im Gegenteil, Militärs und andere Autoritäten wollen ihm ja an den langen, dünnen Kragen. Nein, willkommen ist er in der Familie, in der vaterlosen Kleinfamilie. Hier fehlt einer, der der überforderten Mutter zur Hand geht, vor allem bei der emotionalen Betreuung ihrer Brut. So wie die Deutschen Inder brauchen, weil sie sich mit abstrakten Computern nicht auskennen, brauchten die Amerikaner damals ganz bestimmte Aliens, Emo-Spezialisten, die die konkreten Defizite der All-American-Kleinfamilie kompensieren würden.
Diese Defizite sind nicht irgendwelche, sondern historisch konkrete. Drew Barrymore, später soziopathisches Drogenopfer und noch später wieder Superstar, spricht es mit der beschädigten Niedlichkeit des jüngsten Opfers aus: Unser Papa ist in Mexiko. Der Ort, in den sich Joe flüchtet mit einer Gun in seiner Hand, in dem Beatniks seit den Fünfzigern und Gangster seit dem 19. Jahrhundert vor den USA in ihre zweifelhafte Selbstverwirklichung abhauen. 20 Jahre vor Houellebecq, der dafür die 68er-Frauen verantwortlich machen wird, sind es bei Spielberg noch die Männer, die aus egoistischen Gründen unverantwortlich Löcher in das emotionale Netz reißen - und für die jetzt Facharbeiter aus den Tiefen des Weltraums einspringen müssen.
Ihr seht schon an dem besprochenen und in den Medien diskutierten Buch, an den anderen kurz vorgestellten und diskutierten anderen Büchern, dass die heutige Job-Welt, die heutige Jugendliche zum Erstaunen Älterer schon für selbstverständlich halten, auch die entsprechende Auffassung zum Job, zum Leben überhaupt nach sich zieht. Es ist dies eine echte Paradigmenwende in der Lebensphilosophie.
Diese geänderte Lebensphilosophie scheint einen Generationsbruch, zumindest in den Anschauungen darzustellen, der sich nicht nur in der Ideologie zeigt. Dieser Bruch zeigt sich eben auch in der Ansicht darüber, was Lebensgrück ist, woraus man seine positive Lebenskraft schöpft, was man für sein Leben anstrebt usw.
Das ist nicht nur ein spannendes Thema für mich Alten, sondern eben auch ein Thema für die Gesellschaftspolitik. Mit welchen Auffassungen bekommen wir es zukünftig zu tun? Gibt es zukünftig noch das Streben nach Emanzipation? Will der individuelle Mensch zukünftig privates oder kollektives Lebensglück erreichen?
Es ist auch ein Thema für unsere Szene, denn das hat Auswirkungen auf die Handlungen junger Lesben und Schwuler in der Szene. Und genau deshalb werden wir dem Thema auf der Spur bleiben, mit Eurer Billigung hoffentlich und Eurer Unterstützung. (js)
|
|
|
|